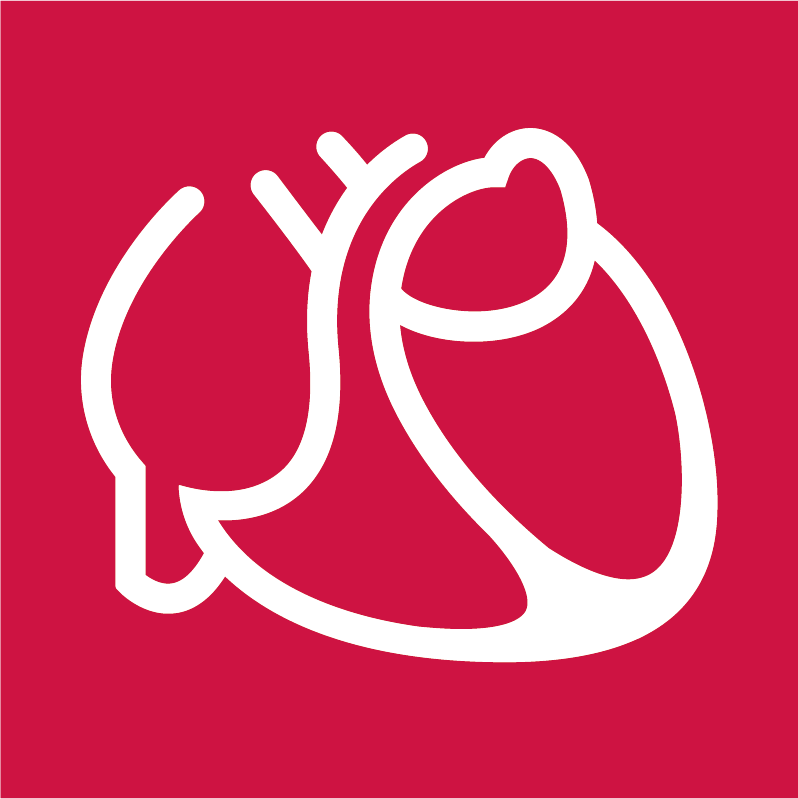Posttraumatischer Stress bei Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler
Abdruck frei nur mit Quellenhinweis
Pressetext als PDF - gegebenenfalls mit Bildmaterial
Annika Freiberger und Caroline Andonian, München
Hintergrund
Angeborene Herzfehler (AHF) zählen zu den häufigsten angeborenen Erkrankungen. Sie treten bei etwa 1 % aller Lebendgeborenen auf. Insbesondere dank beträchtlicher Fortschritte im Bereich der (Kinder-)Kardiologie, Herzchirurgie und Intensivmedizin, ist das Überleben der Betroffenen in den letzten Dekaden so weit gestiegen, dass derzeit in der industrialisierten Welt mehr als 95 % das Erwachsenenalter erreichen. Entsprechend dieser Tendenz leben in Deutschland momentan schätzungsweise 360.000 Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler (EMAH). Trotz aller Behandlungsmöglichkeiten, sind und bleiben Patient*innen mit AHF aber chronisch krank. Viele weisen Rest- und Folgezustände ihrer Erkrankung auf und entwickeln kardiale und nicht-kardiale Begleiterkrankungen. Durch wiederholte Arztbesuche, Behandlungen und Operationen, körperliche Beschwerden, soziale wie berufliche und private Einschränkungen, besteht bei vielen Menschen auch eine verstärkte psychische Belastung. Diese kann sich in unterschiedlicher Art und Weise ausdrücken, beispielsweise in Form von Unsicherheit, Ängsten oder auch depressiven Beschwerden. Psychokardiologische Studien deuten darauf hin, dass psychische Störungen, v.a. Depressionen und Angsterkrankungen, bei EMAH gehäuft auftreten. Allerdings wird aktuell nur ein Bruchteil der Patienten adäquat psychotherapeutisch betreut.
Psychische Belastungen bei EMAH
Psychischen Belastungen oder gar Traumafolgestörungen bei EMAH wurde bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl diese im Kontext ihrer Herzerkrankung häufig multiplen traumatischen Situationen ausgesetzt sind. Als Konsequenz der neu gewonnenen Erkenntnisse ergibt sich nun die Notwendigkeit, neben biomedizinischen Aspekten vermehrt zusätzliche, stärker patientenorientierte, psychosoziale Variablen im Sinne einer ganzheitlichen Versorgung zu berücksichtigen.
Eine psychische Belastung ist auch und gerade bei EMAH in verschiedener Hinsicht von hoher Relevanz: einerseits bleiben diese Beschwerden oder Erkrankungen im Rahmen von körperlichen Erkrankungen häufig unerkannt und können für die Betroffenen beträchtliches Leid und Einschränkungen verursachen. Es droht eine Chronifizierung der Beschwerden und weitere psychische Erkrankungen können sich einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) anschließen. Zum anderen kann eine PTBS den kardiovaskulären Krankheitsverlauf erheblich negativ beeinflussen. Trotz dieser begründeten Vermutungen liegen bislang zu PTBS bei EMAH keine umfassenden systematischen Studien zur Erfassung von Häufigkeit sowie von relevanten Einflussgrößen vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Inzidenz und Prävalenz der PTBS in der organmedizinisch orientierten Versorgung deutlich unterschätzt wird und, dass damit einhergehend, potenziell negative Einflussfaktoren auf den Behandlungsverlauf außer Acht gelassen werden.
Studie zu Häufigkeit und Ausprägung von Traumafolgestörungen
Aktuell wird hierzu in der Klinik für Angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie am Deutschen Herzzentrum München eine Studie von einem multiprofessionellen Team (Leitung: Prof. Dr. Peter Ewert, Prof. Dr. Dr. H. Kaemmerer) durchgeführt. Primäres Ziel ist es, erstmals bei einem großen Kollektiv von EMAH mit allen Schweregraden eines AHF die Häufigkeit und Ausprägung von Traumafolgestörungen festzustellen. Eine Vielzahl validierter psychologischer Methoden wird dabei eingesetzt, um zudem bei EMAH besondere Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung von posttraumatischem Stress zu untersuchen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen Ärzt*innen dazu befähigen, vorhersehbare Risikofaktoren für psychische Belastungen bei EMAH besser zu erkennen und, wenn möglich, diesen präventiv oder möglichst zeitnah nach Auftreten zu begegnen. Langfristiges Ziel ist es, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit AHF ein ganzheitliches Versorgungskonzept zu erstellen, das medizinische und psychosoziale Aspekte gleichermaßen mit einbezieht.
Für die Erhebung der Daten wurden im Zeitraum von November 2021 bis August 2022 erwachsene Patient*innen gebeten, an einer einmaligen Fragebogenerhebung teilzunehmen. Mithilfe von validierten und standardisierten Fragebögen wurde, neben soziodemografischen Daten, der psychische Zustand der Patienten (PTBS-Symptomatik, Angst und Depression, Lebensqualität) sowie Indikatoren der Krankheitsverarbeitung erfasst. Medizinische Daten zum Herzfehler, Operationen und Interventionen wurden anhand der Patientenakten ermittelt.
Ergebnisse der Studie
Insgesamt nahmen 213 Patient*innen (46,9 % weiblich, Durchschnittsalter: 35,07 Jahre +/- 10,7 [18-66]) an der Studie teil. Davon wiesen je nach Fragebogen 17,4 % bzw. 20,2 % posttraumatischen Stress auf (Impact of Event Scale und Posttraumatic Diagnostic Scale); wesentlich höher als in der Gesamtbevölkerung mit ca. 3.5 %. Als Nebenbefund lagen bei 37,6 % der Patient*innen relevante depressive Symptome und bei 46,9 % eine relevante Angstsymptomatik vor. Angegebene traumatische Erfahrungen bezogen sich v.a. auf medizinische Eingriffe, wie Operationen und Interventionen, damit verbundene Trennungserfahrungen von den Eltern im Kindesalter, sowie symptomatische Einschränkungen, wie Herzrasen oder Bewusstseinsverlust. Zudem wurden zukunftsbezogene Ängste, wie die Angst, aufgrund des AHFs nicht schwanger werden zu können, sowie Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf die Operationsvorbereitung, teilweise geschürt durch missverständliche Arzt-Patient Kommunikation, als belastend angeführt. Andere Ängste bezogen sich auf schmerzliche Vorerfahrungen, wie der herzbedingte Tod eines nahen Familienangehörigen, und Alltagsbelastungen, wie Leistungseinschränkungen im Sport. Einige Patient*innen litten unter sozialer Stigmatisierung oder Ausgrenzungserfahrungen, wie Mobbing aufgrund ihrer Operationsnarbe. Signifikante Zusammenhänge zwischen den über Skalen erfassten PTBS-Indikatoren und medizinischen Faktoren konnten zwischen der Anzahl der Operationen, Rhythmusstörungen und Leistungseinschränkungen aufgrund des AHFs gefunden werden. Zu psychosozialen Risikofaktoren zählten das Vorliegen psychischer Probleme in der Vergangenheit sowie Depression und Angststörungen. Den größten Einfluss auf die erhöhten PTBS-Skalenwerte bei EMAH zeigte die erlebte, emotionale Belastung während des traumatisch erlebten Ereignisses. Auf dem Boden der erhobenen Daten wird bereits an einer weiteren Untersuchung gearbeitet, die das subjektive Erleben der Patienten detailliert erfassen soll.
Fazit
Da es Patient*innen häufig schwerfällt, spontan über psychische Belastungen zu sprechen, sollten die aktuell vorgelegten Ergebnisse Ärzt*innen dazu ermutigen, diese systematisch abzufragen und damit den komplexen psychosozialen Bedürfnissen von Patient*innen mit AHF Rechnung zu tragen. In Zeiten stetig wachsender Patientenzahlen bei gleichzeitig knappen Personalressourcen ist eine effektive Diagnostik psychosozialer Probleme und zeitnahe Einleitung einer wirkungsvollen psychosozialen Therapie notwendig.
Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz und Kreislaufforschung e.V. (DGK) mit Sitz in Düsseldorf ist eine gemeinnützige wissenschaftlich medizinische Fachgesellschaft mit fast 11.000 Mitgliedern. Sie ist die älteste und größte kardiologische Gesellschaft in Europa. Ihr Ziel ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der kardiovaskulären Erkrankungen, die Ausrichtung von Tagungen die Aus-, Weiter- und Fortbildung ihrer Mitglieder und die Erstellung von Leitlinien. Weitere Informationen unter www.dgk.org