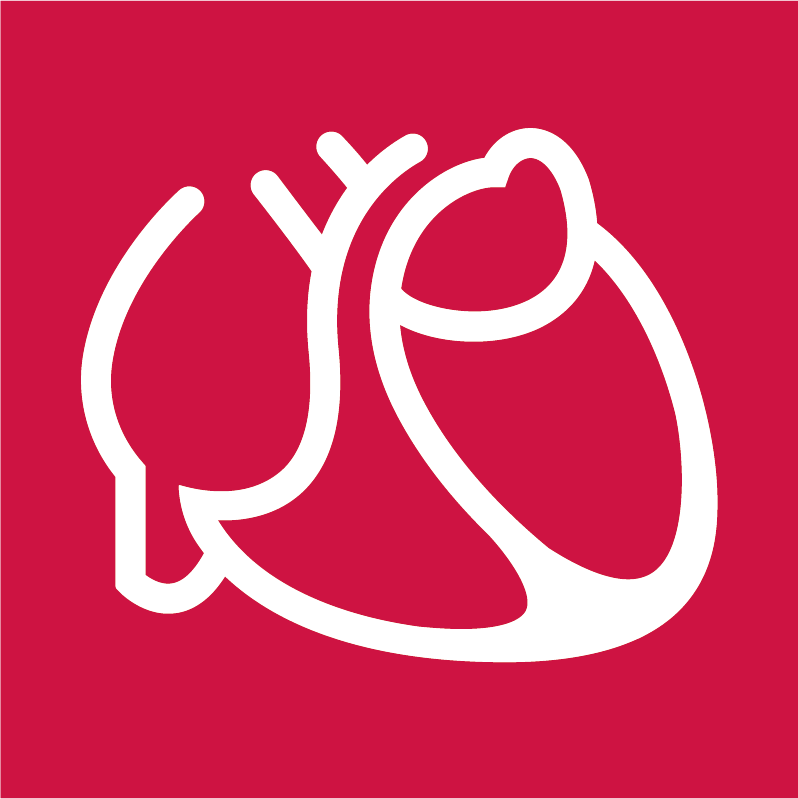Pressetext als PDF Statement von Prof. Dr. Raimund Erbel / Essen
Aktuelle Studiendaten zeigen, dass die Bildung atherosklerotischer Gefäßveränderungen umkehrbar ist. Unter Therapie mit hochdosierten Statinen werden die gefährlichen Plaques in den Gefäßen nachweislich kleiner. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass strenge Zielwerte für das LDL-Cholesterin erreicht und eingehalten werden.
Atherosklerose ist keine pathologische Einbahnstraße. Das legen aktuelle Daten zur Wirksamkeit blutfettsenkender Medikamente (Statine) nahe. War man bis vor kurzem davon ausgegangen, dass der Prozess der Plaque-Bildung, wenn er einmal begonnen hat, bestenfalls verlangsamt werden kann, so zeigen die Ergebnisse der SATURN-Studie (Study of CoronaryAtheroma by InTravascular Ultrasound: Effect of Rosuvastatin Versus AtorvastatiN), dass es auch in die andere Richtung geht: Atherome (atherosklerotisches Plaques) können unter Therapie schrumpfen. Das ist eine ganz wichtige Studie, die erstmals prospektiv gezeigt hat, dass es bei etwa zwei Dritteln der Patienten zu einer Regression der Plaques kommt, wenn ein LDL-Cholesterin unter 70 mg/dl erreicht wird.
Studienziel von SATURN war eigentlich, Unterschiede in der Wirksamkeit zwischen den beiden Statinen Atorvastatin und Rosuvastatin nachzuweisen, da das HDL unter Rosuvastatin-Therapie stärker als unter Atorvastatin bei gleichzeitiger Absenkung des LDL ansteigt. In der Studie bediente man sich unter anderem einer Methode, die in Statin-Studien eher selten zum Einsatz kommt: Der direkten Kontrolle der atherosklerotischen Gefäßveränderungen mittels intravaskulärem Ultraschall (IVUS). Diese Methode erlaubt gewissermaßen einen direkten Blick auf die Gefäßwand, hat jedoch den Nachteil, dass sie invasiv – es muss eine Ultraschall-Sonde in das Gefäß eingeführt werden – und aufwändig ist und daher nicht zu den klinischen Routineuntersuchungen zählt. Der Vorteil des IVUS liegt jedoch darin, dass er es erlaubt, die unmittelbaren Auswirkungen der Therapie auf die Atherosklerose zu bewerten, während man üblicherweise auf klinische Endpunkte angewiesen ist. Eine Rückbildung der Plaques kann in solchen Endpunktstudien jedoch nur vermutet, nicht nachgewiesen werden.
SATURN zeigte eine gewisse, nicht signifikante Überlegenheit von Rosuvastatin im Vergleich zu Atorvastatin, darüber hinaus jedoch in beiden Gruppen bei intensiver Therapie eine Regression der Plaques, die bei mehr als zwei Drittel der Patienten an Volumen abnahmen. Nach zweijähriger, hochdosierter Therapie erreichten die mit Rosuvastatin behandelten Patienten ein etwas niedrigeres LDL-Cholesterin (62,6 vs. 70,2 mg/dl) und auch höhere HDL-Cholesterinwerte (50,4 vs. 48,6 mg/dl). Mittels IVUS wurden das relative Atheromvolumen im Verhältnis zur Größe der Koronarie (percent atheroma volume, PAV) und das absolute Atheromvolumen (total atheroma volume, TAV) ermittelt. Hinsichtlich des PAV (des primären Endpunkts der Studie) ergab sich eine Reduktion von 0,99 Prozent unter Atorvastatin und 1,22 Prozent unter Rosuvastatin. Die Differenz war nicht signifikant. Hinsichtlich des sekundären Endpunkts PAV erwies sich Rosuvastatin als signifikant überlegen.
Obwohl das primäre Studienziel nicht erreicht wurde, ist das Ergebnis von SATURN als sensationeller Befund zu werten, zeigt es doch, dass die Atherosklerose bei geeigneter Therapie reversibel ist. Die Dosis der Statine muss bei Risikopersonen hoch genug sein. Das ist das wichtigste. Das LDL-Cholesterin muss unter 80 mg/dl gesenkt werden, in den USA gilt sogar ein Zielwert von 70 mg/dl. Deshalb wurde in früheren Studien auch keine Rückbildung der Plaques gesehen. Die LDL-Senkung war einfach nicht deutlich genug. Das liegt zum Teil auch daran, dass man mit den älteren Statinen die heutigen Zielwerte in den meisten Fällen gar nicht erreichen kann. Die Rückbildung der Plaques wird sich langfristig in einer Reduktion klinischer Ereignisse niederschlagen. Regression bedeutet weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle. Die Therapie mit hochdosierten Statinen ist jedenfalls machbar, zumal die Nebenwirkungsrate in SATURN erfreulich gering war. Bei keinem einzigen der rund 1000 Patienten trat eine Rhabdomyolyse, die gefürchtetste Komplikation der Statin-Therapie, auf.
Kontakt:
Prof. Dr. Raimund Erbel
Universitätsklinikum Essen
Klinik für Kardiologie
Hufelandstr. 55
45122 Essen
Tel.: 0201 723-4800
Fax: 0201 723-5401
E-Mail: erbel@uk-essen.de